Äthiopien will bis Oktober vier Milliarden Bäume pflanzen. Allein Anfang dieser Woche sollen die rund 100 Millionen Äthiopier binnen 12 Stunden fast 354 Millionen Setzlinge in den Boden gebracht haben. Das berichten übereinstimmend diverse Medien, z.B. Spiegel online.
Zuerst dachte ich an eine PR-Aktion oder einen symbolischen Hilferuf, der auf die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen soll, ähnlich der berühmt gewordenen „Unterwassersitzung“ der Regierung der Malediven.

Tatsächlich aber ist die weltweite Medienresonanz allenfalls ein (gewollter) Nebeneffekt der Aktion: Sie ist Teil der „green-legacy“-Initiative der äthiopischen Regierung. Deren Ziel ist „… to become a green society by planting various types of eco-friendly seedling to combat environmental degradation“. Denn ein Großteil der rund 100 Millionen Äthiopier lebt von der Landwirtschaft. Aber Überschwemmungen und Abholzungen machen den Boden immer unwirtlicher. Von einstmals rund 35 Prozent ist der Anteil der bewaldeten Landesfläche auf nurmehr rund 4 Prozent geschrumpft. Dem soll die staatliche Pflanzaktion entgegensteuern.
Es geht also tatsächlich um praktische Wiederaufforstung, nicht um medienwirksame Lippenbekenntnisse. Davon ließe sich lernen.


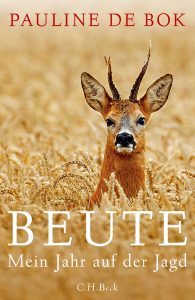
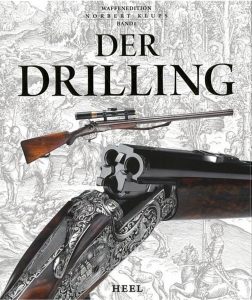
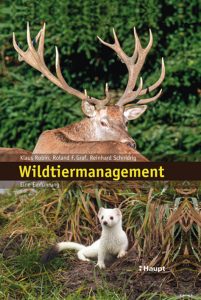
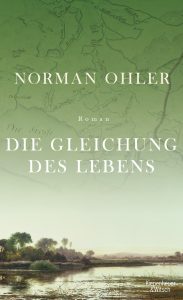
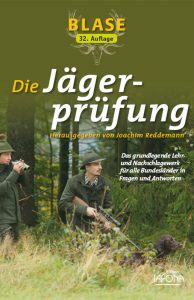
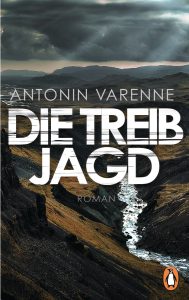
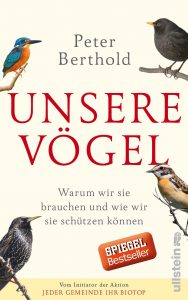
Neueste Kommentare