
Das Magazin Walden bedient den Leserkreis der jungen Outdoor-Hipster (äußere Merkmale: Strickmütze und Fusselbart). Seit 2015 erscheinen zwei Ausgaben pro Jahr, immer „voller Inspirationen für Abenteuer vor unserer Haustür“, so die Selbstbeschreibung. Walden wird gemacht für Leute, die gerne draußen sind, ohne gleich Extrembergsteiger oder Einhandsegler sein zu wollen.
Menschen mit grünem Abitur sei dieses Magazin eher nicht empfohlen. Aber eine Rubrik daraus hat Barbara Lich jetzt in erweiterter Form als Walden Field Guide veröffentlicht – und das ist ein Naturführer der besonderen Art geworden: weder Survival-Anleitung noch Bestimmungsbuch, vielmehr ein „Programmheft für Flora und Fauna in Deutschland“. Für jeden Monat des Jahres gibt es ein wenig Statistik und einen „Natur-Ticker“ mit Stichworten, außerdem werden jahreszeittypische Naturphänomene beschrieben und ein Tier des Monats vorgestellt. Nicht zuletzt wird auch die eine oder andere Frage beantwortet, die einen immer schon umgetrieben hat: Warum, beispielsweise, duftet Sommerregen?
Was dieses Büchlein besonders empfehlenswert macht, ist die frische, heitere und durchgängig von Wortspielerei geprägte Sprache. Selbst wenn das nicht die eigentliche Zielgruppe sein dürfte, so könnte dieser Field Guide vielleicht sogar unsere lieben Heranwachsenden dazu animieren, ihre Smartphones beiseite zu legen und einfach mal nach draußen zu gehen.
Barbara Lich, Der Walden Field Guide. Das ganze Jahr unterwegs in Deutschland, Ullstein Verlag 2016, 240 Seiten, 12,00 Euro
Erhältlich beim Buchhändler Deines Vertrauens
und online bei amazon oder buch7
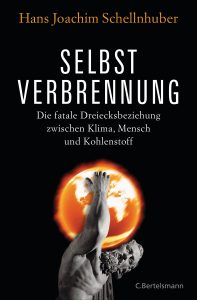
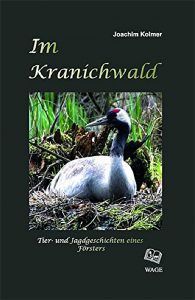
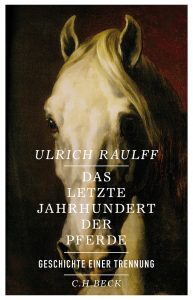
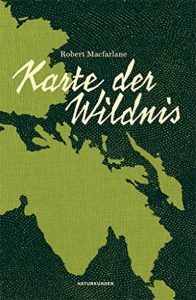

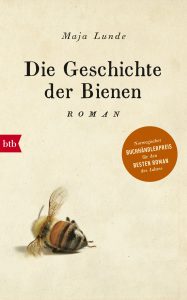


Neueste Kommentare