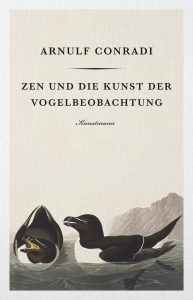
Lange Zeit galten Vogelbeobachter als verschrobene Gesellen. Das hat sich geändert, heute heißt ihr Hobby „Birdwatching“ und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Kein Wunder, ist doch die Begeisterung für die gefiederten Tiere, für ihre Vielfalt, Farbenpracht oder Flugkünste, alles andere als verschroben.
Aber ist das Vogelbeobachten wirklich nur ein Hobby? Für Arnulf Conradi nicht. Aus Sicht des Verlegers, Herausgebers und Autors ist es vielmehr eine Kunst, ja mehr noch: eine Lebensform, ein Habitus. Der wahre Vogelbeobachter, schreibt Conradi, lebe seine Passion fortwährend und in jeder Situation. Im Akt des Beobachtens sei er ganz in der Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft verschwänden vollständig in der Besinnung auf den beobachteten Vogel. Conradi vergleicht das mit der Achtsamkeitsmeditation, die ebenfalls nicht verändern wolle, sondern nur wahrnehmen, was ist. Schon der Zen-Buddhismus, aus dem diese Form der Meditation ursprünglich stamme, lebe aus einem tiefen Bezug zur Natur.
Das Buch ist also weder praktisches Vademecum für Birdwatcher noch Bestimmungsbuch (keine Abbildungen!). Es bietet vielmehr kluge und anregende Reflexionen, lebendige Darstellungen von Vögeln in ihren Habitaten sowie Reise- und Landschaftsbeschreibungen. Geografisch reicht das Spektrum von der Antarktis bis Helgoland, von den Alpen bis Sylt, vom Grunewald über die Uckermark bis zur Peene. Ornithologisch reicht es vom Albatros über Greife und Entenvögel bis zu Amsel, Drossel, Fink und Star. Und zeitlich über sechs Jahrzehnte einer großen Passion.
Conradi, Arnulf: Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung, erschienen 2019 im Verlag Antje Kunstmann, 240 Seiten, gebunden, 20,00 Euro
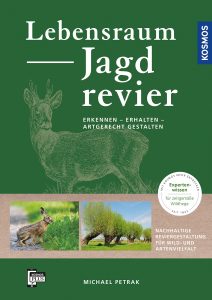
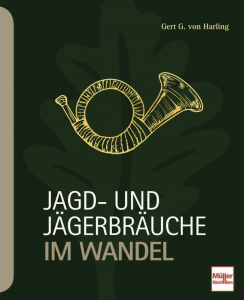


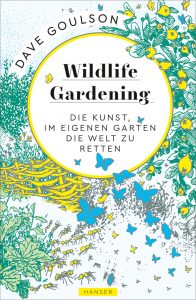

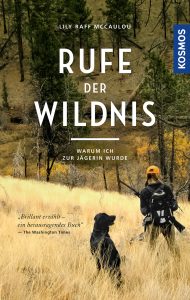
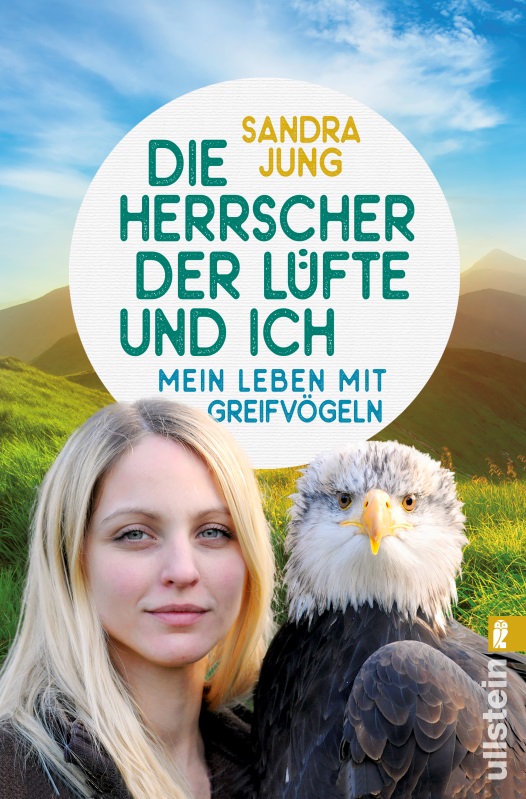
Neueste Kommentare