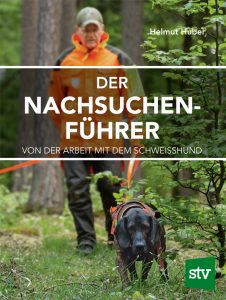
Von den vielen Büchern zum Thema Schweißarbeit/Nachsuche, die in den letzten Jahren erschienen sind, ist dieses möglicherweise das schlechteste: „Der Nachsuchenführer“ von Helmut Huber. Wer angesichts des Titels vermutet hat, es gehe darin um die Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen am anderen Ende des Schweißriemens, um praktische Erfahrungen gar oder um nützliche Tipps, wird bitter enttäuscht sein.
Denn am Ende der 144 Seiten, auf denen sich erzählende und belehrende Passagen abwechseln, steht nur soviel fest: Nachsuchenführer sind ganz harte Kerle, scheuen weder Regen noch Kälte, haben die Kondition von zwei Marathonläufern und die Weisheit eines Obi-Wan Kenobi. Gerufen werden sie eigentlich immer nur von Vollpfosten, die kaum Hirsche und Sauen unterscheiden können und ihre Jagdscheine in Schnellkursen mit Erfolgsgarantie ergattert haben. Und Frauen kommen in der rauen Männerwelt der Schweißarbeit nur als verständnisvolle Ehefrauen der Nachsuchenführer und Kaffeekocherinnen am Streckenplatz vor.
Sympathisch daran ist allenfalls der ostentative Verzicht des Autors auf Ausrüstungsfirlefanz. Die Vorstellung, wie der alte Opel Corsa neben all den SUVs und Pick-ups anhält, ein Hannoverscher Schweißhund vom Beifahrersitz springt und der Hundeführer seinen 98er schultert, lässt einen durchaus schmunzeln.
Aber die Lachmuskeln verspannen sogleich angesichts der einen oder anderen ebenso dogmatisch vorgebrachten wie falschen Behauptung, wie etwa dieser: Die ersten 10 Lebenswochen prägen einen Hund überhaupt nicht (S. 14); Im Haus darf niemals gefüttert werden (15f); Zur Durchsetzung der Stubenreinheit sollte ein Hund kräftig am Genick geschüttelt werden (16). Wenn der Autor dann auch noch zugibt, an der Kirrung den Sauen aufs Haupt zu schießen (37), von der Naturbelassenheit ehemaliger Truppenübungsplätze schwärmt (53) und sich zuletzt auch noch die skurrilen Thesen Peter Wohllebens zueigen macht (116), steigen sicher auch wohlmeinende Leserinnen und Leser aus.
Da mag eine Schlussbemerkung über den Schreibstil anmuten wie ein Fangschuss auf einen bereits aufgebrochenen IIb-Hirsch: Stilblüten wie „Die Spannung war zum Greifen nah“ runden das Gesamtwerk ab.
Helmut Huber, Der Nachsuchenführer. Von der Arbeit mit dem Schweißhund, Stocker Verlag 2020, Hardcover 144 Seiten, 29,90 Euro
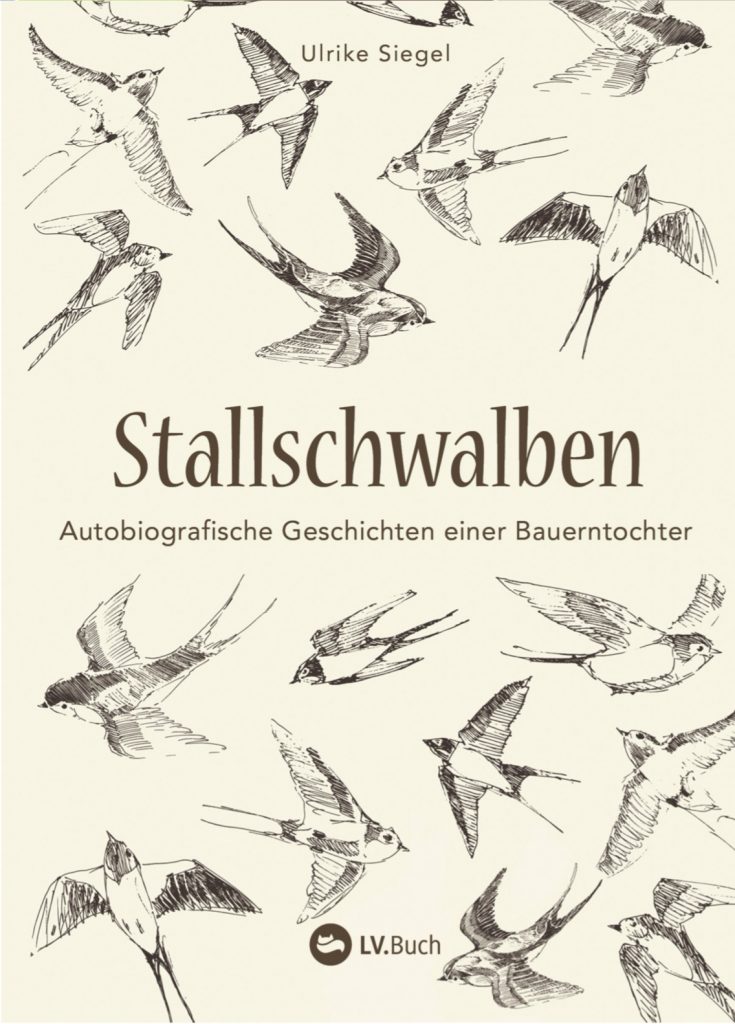
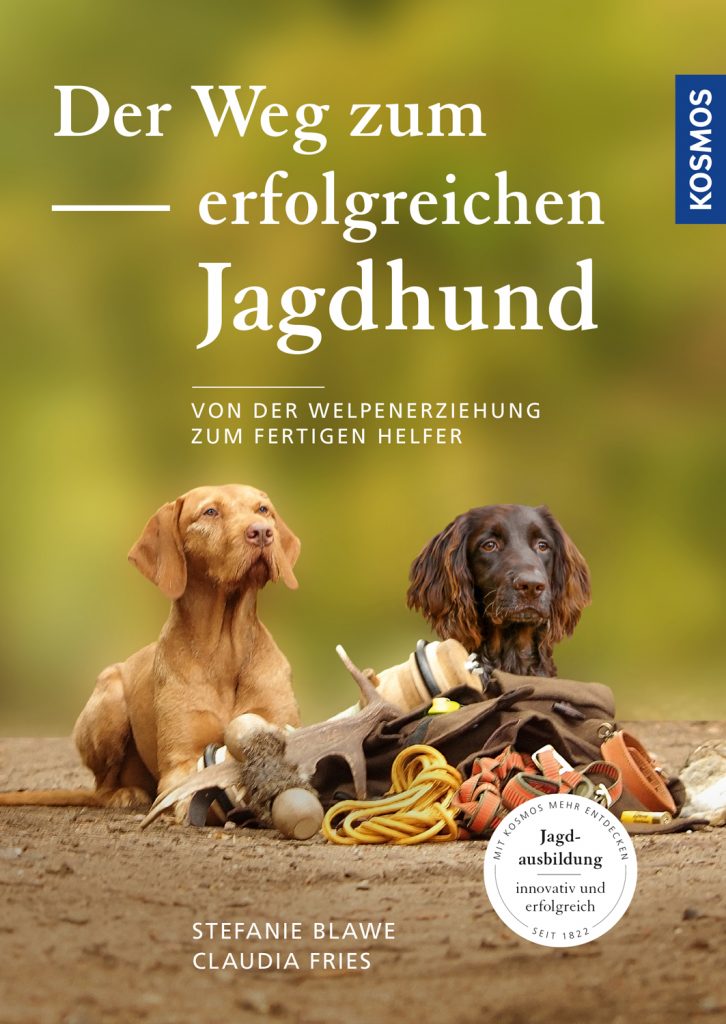
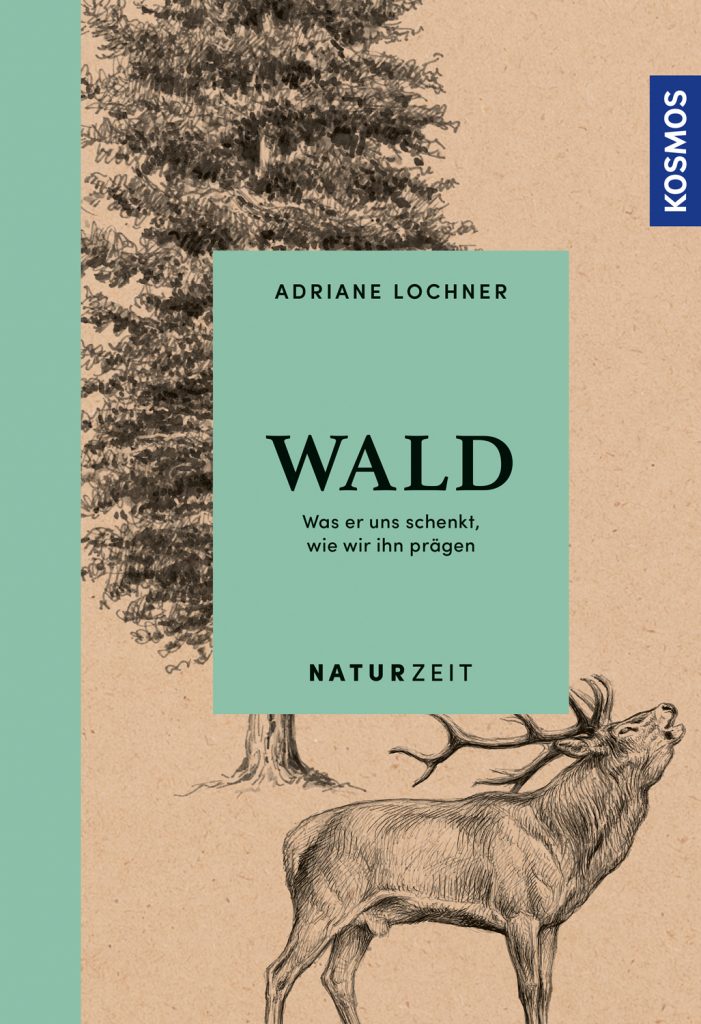
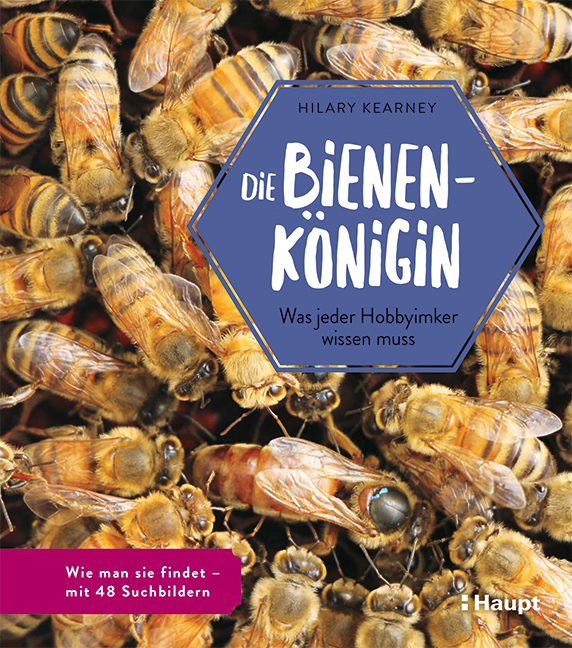
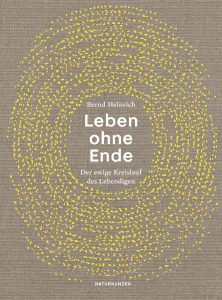
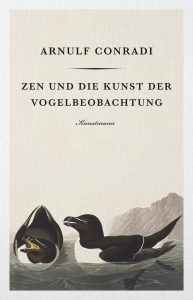
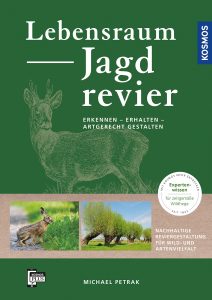
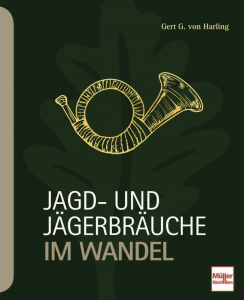
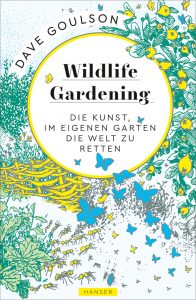
Neueste Kommentare